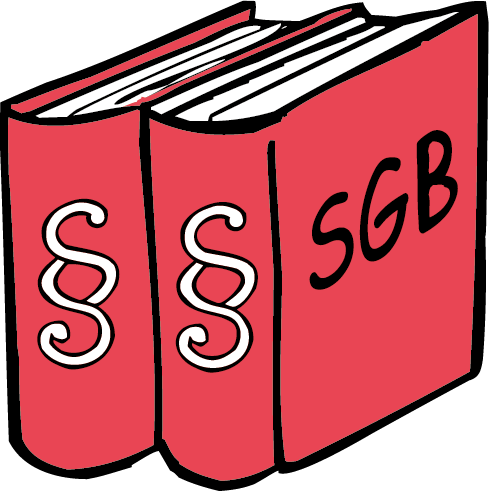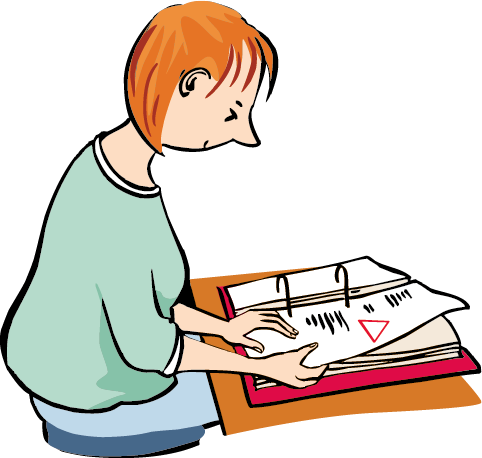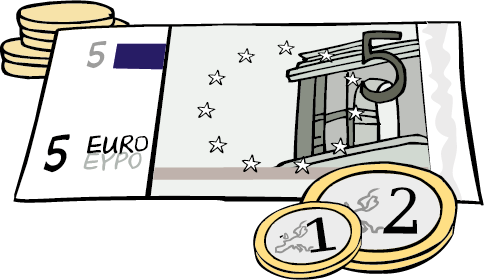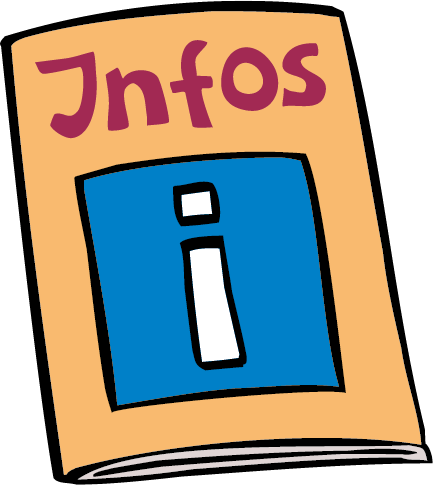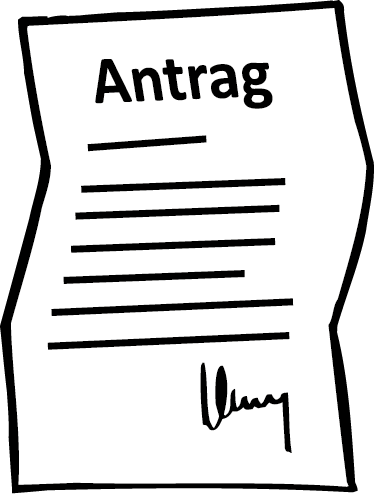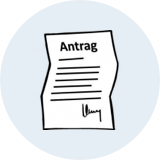Freiwillige Leistung des Landschaftsverbands zur Förderung der schulischen Inklusion
Voraussetzungen
Sie haben einen Anspruch auf Leistungen der LVR-Inklusionspauschale, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:
- Der Schüler/die Schülerin muss einen vorrangigen Förderschwerpunkt in den Bereichen Sehen, Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische Entwicklung oder Sprache (Sek. I) haben.
- Der Antragsteller muss der Schulträger der allgemeinen Schule sein.
- Der Antrag muss vor Aufnahme der Schülerin/des Schülers gestellt werden.
Ausnahme: Der Förderbedarf wird erst während des Schulbesuchs festgestellt.
- Der Belastungsausgleich (Landesmittel für die schulische Inklusion) muss bereits verausgabt oder fest verplant sein.
Ausnahme: Die Kommune befindet sich im Stärkungspaket.
- Die Schule muss sich im räumlichen Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes Rheinland befinden.
- Es müssen konkrete Bedarfe für spezielle Ausstattung oder Umbaumaßnahmen vorliegen, die im Zusammenhang mit dem Gemeinsamen Lernen stehen.
- Kostenvoranschläge für die geplanten Maßnahmen müssen beigefügt werden.
- Der Antrag muss fristgerecht vor dem 31. Mai eingereicht werden.
Rechtsgrundlage
- Förderzweck:
Art. 24 der UN-BRK (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen)
- Geltungsbereich und Zuwendungsempfänger:
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) vom 15. Februar 2005 §§ 78 ff.
Zuletzt geändert am 23.02.2022
- Fördervoraussetzungen:
Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung NRW (AO-SF)
- Bewilligungsverfahren: Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
- Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
Satzung über die Förderung der Inklusion in allgemeinen Schulen im Gebiet des Rheinlandes vom 19. Dezember 2018. Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 28.Juni 2017 außer Kraft.
Erforderliche Unterlagen
- Angaben zum Schüler/zur Schülerin:
Nachweis des festgestellten vorrangigen Förderschwerpunkts (z. B. Bescheid des Schulamtes (AOSF))
- Angaben zum Fördergegenstand/zu den Bedarfen:
Kostenvoranschläge für spezielle Ausstattung und Umbaumaßnahmen
Verfahrensablauf
Um die LVR-Inklusionspauschale für die Beschulung im Gemeinsamen Lernen zu beantragen, folgen Sie diesem Verfahrensablauf:
o Antragstellung:
- Füllen Sie das Antragsformular online vollständig aus.
- Achten Sie darauf, dass alle Angaben zum Schüler/zur Schülerin, zum geplanten Förderort und zu den Fördergegenständen korrekt und vollständig sind.
o Einreichen des Antrags:
- Senden Sie den vollständig ausgefüllten Antrag fristgerecht vor dem 31. Mai ab.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Unterlagen, einschließlich der Nachweise über den vorrangigen Förderschwerpunkt und die Kostenvoranschläge, beigefügt sind.
o Prüfung der Förderfähigkeit:
- Der LVR prüft nach pflichtgemäßem Ermessen die grundsätzliche Förderfähigkeit anhand der vorliegenden Unterlagen.
o Ermittlung der Förderhöhe:
- Nach dem Stichtag (31. Mai) wird die voraussichtliche Förderhöhe in Abhängigkeit des Gesamtantragsvolumens festgelegt.
- Eine prozentuale Kürzung über alle förderfähigen Anträge erfolgt, wenn das Gesamtantragsvolumen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel übersteigt.
o Bescheid und Fördergelder:
- Bei positivem Bescheid erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid über die voraussichtlich erstattungsfähigen Kosten.
- Die ermittelten Förderbeträge werden an die Antragsteller ausgezahlt.
- Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen und Bestätigung der Förderfähigkeit kann mit der Umsetzung der beantragten Maßnahme begonnen werden.
- Weisen Sie die Mittelverausgabung nach Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31. Juli des Folgejahres mit einem vereinfachten Verwendungsnachweis nach.
o Nachkontrolle und Abschluss:
- Der LVR-Fachbereich überprüft die Mittelverwendung und kann bei Abweichungen einen Anteil zurückfordern.
- Eine nachträgliche Erhöhung der Fördergelder ist nicht möglich.
Fristen
Der Antrag auf LVR-Inklusionspauschale muss vor dem 31. Mai eines jeden Jahres eingereicht werden. Eine fristgerechte Einreichung ist wichtig, um eine rechtzeitige Prüfung und Bearbeitung zu ermöglichen.
Bearbeitungsdauer
Die Dauer des Prozesses aus Beratung, Bearbeitung ist abhängig vom Einzelfall und kann daher variieren.
Weiterführende Informationen

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVREingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung (Pflegefamilien, Wohneinrichtungen)
Eingliederungshilfe bietet Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die in einer Wohneinrichtung oder Pflegefamilie leben.
Sie haben Fragen zum Hilfeprozess oder Antragsverfahren?
Wenn Sie einen Antrag stellen, möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landschaftsverbandes herausfinden, was Sie genau brauchen.
Dazu führen sie ein persönliches Gespräch mit Ihnen oder lesen es in den Unterlagen nach, die Sie eingereicht haben.
Eltern, die für ihr Kind die Unterstützung in einer Wohneinrichtung beantragen wollen, wenden sich an den für ihre Region zuständigen Fallmanager oder die Fallmanagerin. Der LVR finanziert den Lebensunterhalt und die fachliche Unterstützung in einer Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche bis zum Abschluss der Schulausbildung.
Sie sind eine Pflegefamilie, pflegen ein Kind mit einer körperlichen und / oder geistigen Behinderung und haben Fragen? Sie haben einen Unterstützungsbedarf im Bereich der Erziehung?
Ihre Fragen können Sie gerne – telefonisch oder persönlich - vor Ort stellen. Der Landschaftsverband informiert auch über Unterstützungsmöglichkeiten anderer Leistungsträger, wie z.B. Krankenkassen oder dem örtlichen Sozialamt.
Die Form der Leistung kann unterschiedlich sein. Neben Sachleistungen - etwa die Finanzierung eines Leistungserbringers – sind auch Pauschalen oder Geldleistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets möglich.
Voraussetzungen
Sie haben einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Das sind die Voraussetzungen:
- Die leistungssuchende Person ist aufgrund Ihrer Behinderung oder einer bald eintretenden Behinderung wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt. Dies können wesentliche körperliche, geistige oder seelische Behinderungen oder Sinnesbeeinträchtigungen sein.
- Die Leistung ist geeignet und erforderlich, eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.
Das heißt, die Leistung ist gut und kann Ihnen helfen, damit Sie Ihr Leben so führen können, wie Sie es möchten und damit Sie am Leben in der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können. Ohne diese Leistung wäre das nicht möglich.
- Es besteht die Aussicht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.
Das bedeutet: Es muss möglich sein, dass Sie mit der Leistung die Ziele der Eingliederungshilfe erreichen.
Eventuell müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist abhängig von der Leistung, die Sie beantragt haben.
Rechtsgrundlage
Grundsätzliche Informationen:
§§ 99 und 102 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
§ 99 Sozialgesetzbuch Neuntes Buche (SGB IX)
§ 102 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Weiterführende Regelungen:
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 111 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe gemäß § 113 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
- Medizinische Rehabilitation § 109 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) (nur in Bezug auf Entwöhnungen und Adaptionen)
- Zuständigkeit der Landschaftsverbände für Eingliederungshilfe-Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen gemäß § 1 Absatz 1 AG SGB IX NRW
- Beratung und Unterstützung gemäß § 106 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Bedarfsermittlung gemäß § 118 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Regelungen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen gemäß Teil 2, Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Kapitel 9
Sprachen
- Das Verfahren wird grundsätzlich in deutscher Sprache durchgeführt
- Bei Beratung und Antragstellung kann bei Bedarf durch Sie eine dolmetschende Person hinzugezogen werden
- Bitte geben Sie an, wenn eine gebärdensprachdolmetschende Person erforderlich ist. Die Kosten hierfür werden vom Landschaftsverband übernommen.
Erforderliche Unterlagen
- Erforderlich ist ein Antrag, der jedoch formlos oder auch mündlich erfolgen kann.
- Persönliche Daten mit Ergänzung entsprechender Nachweise
- Nachweis über die Behinderung (fachärztliche Bescheinigung)
- Bei Unterstützung durch Dritte: Vollmacht (wenn Sie andere Personen um Hilfe beim Antrag bitten)
- Bei Betreuung: Betreuungsurkunde (wenn Sie einen rechtlich bestellten Betreuer haben)
- Bei Pflegegrad: Bescheid der Pflegekasse über Feststellung des Pflegegrades
- Abhängig von der beantragten Leistung werden ggf. weitere Unterlagen benötigt
- Im Beratungsgespräch klären die Mitarbeitenden mit Ihnen, welche weiteren Unterlagen erforderlich sind
Verfahrensablauf
Sie können Eingliederungshilfe bei Ihrem zuständigen Landschaftsverband beantragen.
Innerhalb von 2 Wochen ab Antragseingang wird die Zuständigkeit geprüft. Sollte ein anderer Träger zuständig sein, wird Ihr Antrag unverzüglich weitergeleitet. Über eine Weiterleitung werden Sie informiert.
Sie werden bei Bedarf aufgefordert, Unterlagen nachzureichen.
Die erforderlichen Unterstützungsleistungen werden mit Ihnen gemeinsam ermittelt.
Sie erhalten einen Bescheid über Ihren Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Sie müssen dem Landschaftsverband Änderungen Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse immer zeitnah mitteilen.
Eine Überprüfung der bewilligten Leistungen erfolgt in der Regel spätestens alle 2 Jahre. Wenn sich zwischendurch etwas ändert, informieren Sie den Landschaftsverband. Dann wird die Leistung angepasst.
Fristen
Die Leistungen werden frühestens ab dem Ersten des Monats der Antragstellung erbracht, wenn zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen bereits vorlagen.
Bearbeitungsdauer
Die Dauer des Prozesses aus Beratung, Bearbeitung und Abstimmung mit anderen Leistungsträgern ist abhängig vom Einzelfall und daher sehr unterschiedlich. Sie können den Prozess beschleunigen, wenn Sie zeitnah alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen.
Kosten
Es fallen keine Gebühren an für die Antragsstellung. Sollten Kosten entstehen, können Sie das gerne vorab mit ihrem zuständigen Landschaftsverband klären.
Online-Identifizierung
Mit der Bund ID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein Bund ID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
Weiterführende Informationen
Für den LVR:
- Allgemeinen Informationen zu den Leistungen des LVR-Dezernates für Menschen mit Behinderungen:
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung/kinder_und_jugendliche/pflegefamilien/pflegefamilien_1.jsp
- Unterstützung und Beratung im Bereich Wohnen und Alltag
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/wohnen-und-alltag/
- Unterstützung und Beratung im Bereich Pflegefamilie für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/pflegefamilie-fuer-kinder-und-jugendliche-mit-behinderung/
- Allgemeine Beratung vor Ort zu weiteren Leistungen
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/allgemeine-beratung-und-unterstuetzung-fuer-menschen-mit-behinderung/
- Informationen zur Bedarfsermittlung
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/arbeit-und-behinderung/bedarfsermittlung-fuer-menschen-mit-behinderung/
Allgemein:
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/teilhabe-und-inklusion.html

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRHilfe zur Pflege Bewilligung
Wenn Sie durch gesundheitliche Beeinträchtigungen auf die Hilfe anderer angewiesen sind, haben Sie unter bestimmten Umständen neben den Ansprüchen aus der Pflegeversicherung einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII).
Grund für den Bedarf können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder auch gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen sein, die nicht selbständig kompensiert und bewältigt werden können.
Die Feststellung, ob und in welchem Umfang Pflegebedürftigkeit vorliegt, erfolgt durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), welcher von Ihrer Pflegeversicherung beauftragt wird. Nähere Auskünfte zu dem Feststellungsverfahren erhalten Sie bei Ihrer Pflegeversicherung.
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) ermittelt Ihre Pflegebedürftigkeit. Dabei wird beurteilt, wie selbstständig Sie Ihren Alltag noch bewältigen können. Der Pflegegrad wird mit einem Punktesystem bestimmt. Ihre zuständige Pflegekasse ist dann für die Übernahme der Pflegekosten zuständig. Allerdings werden die Kosten von der Pflegeversicherung je nach Leistungsart nur bis zu bestimmten Höchstgrenzen übernommen. Ist Ihnen die Übernahme der ungedeckten Restkosten nicht möglich, kommen unter Berücksichtigung der Feststellungen des MDK Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) – wie die Hilfe zur Pflege - in Frage.
Sollten Sie nicht pflegeversichert sein und somit kein Gutachten des MDK und keine Einstufung in einen Pflegegrad durch die Pflegekasse erhalten, kann der Sozialhilfeträger das jeweils zuständige Gesundheitsamt (sog. Amtsarzt) mit einer Begutachtung beauftragen.
Sie erhalten Hilfe zur Pflege nur dann, wenn Ihr Einkommen und Vermögen (oder das Ihres Ehe- oder Lebenspartners) nicht ausreichen. Unterhaltspflichtige Angehörige werden herangezogen, sofern deren jährliches Bruttoeinkommen mehr als 100.000,00 EUR beträgt, siehe auch Gesetz zur Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger in der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (sog. Angehörigen-Entlastungsgesetz).
Sie haben Anspruch auf folgende Leistungen:
Ab Pflegegrad 1:
- Pflegehilfsmittel
- Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes;
- Digitale Pflegeanwendungen
- Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen
- Einen Entlastungsbetrag.
Ab Pflegegrad 2 - 5:
- Häusliche Pflege (in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, anderen Leistungen, digitalen Pflegeanwendungen, ergänzender Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen)
- Teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- Einen Entlastungsbetrag
- Stationäre Pflege
Die Hilfe zur Pflege wird von der zuständigen Behörde nach Prüfung Ihrer Unterlagen gewährt, sofern die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen.
Voraussetzungen
Sie müssen eine körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigung haben, die Ihre Selbstständigkeit erschwert (mindestens Pflegegrad 1).
Sie (oder Ihre nicht getrennt lebende Ehegattin oder Lebenspartnerin bzw. Ihr nicht getrenntlebender Ehegatte oder Lebenspartner) verfügen über nicht genügend Einkommen oder Vermögen, um die Pflegekosten zu decken.
Erforderliche Unterlagen
Frühere Leistungsbezüge
Bei Pflegeversicherten:
- Nachweis Mitgliedsbescheinigung Kranken und Pflegeversicherung
- Medizinisches Gutachten des Medizinischen Diensts der Krankenversicherung
- Bescheid der Pflegekasse über Pflegegrad und Leistungen der Pflegeversicherung
Bei Nicht-Pflegeversicherten:
- Ärztlicher Bericht
Verfahrensablauf
Nach Antragstellung werden die von Ihnen eingereichten Unterlagen geprüft und, falls erforderlich, die Pflegebedürftigkeit bestimmt.
Außerdem werden Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse geprüft. Ist die pflegebedürftige Person minderjährig und unverheiratet, wird das Einkommen und Vermögen ihrer Eltern berücksichtigt.
Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid.
Bearbeitungsdauer
Über den Antrag wird so schnell wie möglich entschieden. Die Bearbeitungsdauer hängt unter anderem von der Vollständigkeit der Angaben und der Vorlage der für die Antragsbearbeitung erforderlichen Nachweise ab.
Online-Identifizierung
Mit der BundID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein BundID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
Weiterführende Informationen
Zum 01.01.2017 wurden die bisher geltenden Pflegestufen „0“, 1, 2 und 3 von den fünf neuen Pflegegraden 1, 2, 3, 4 und 5 abgelöst.
Seitdem dienen Pflegegrad 1, Pflegegrad 2, Pflegegrad 3, Pflegegrad 4 und Pflegegrad 5 zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit von Betroffenen.
Diese Änderungen sollen im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) vor allem demenzkranken Älteren die gleichen Pflegeleistungen zusichern wie körperlich Pflegebedürftigen.
Hinweise
Obwohl ein formloser Antrag möglich ist, benötigen wir von Ihnen im Nachgang das ausgefüllte Antragsformular.
Hier gelangen Sie zum Online-Antrag auf Leistungen der Sozialhilfe

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRHilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)
Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten umfasst Beratung und persönliche Unterstützung der Leistungsberechtigten und ihrer Angehörigen. Soziale Schwierigkeiten liegen vor, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten wesentlich eingeschränkt ist.
Ziel der Hilfe ist es, betroffene Personen zu einer selbstständigen Lebensbewältigung im Alltag entsprechend ihren Möglichkeiten zu befähigen und eine Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.
Die Hilfe umfasst alle notwendigen Maßnahmen, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten zu beseitigen. Dazu zählen insbesondere:
- Ambulante oder stationäre Betreuung
- Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung
- Maßnahmen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes
- Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags
- Hilfe für Strafgefangene (befristete Mietübernahme während der Haft)
- Hilfe bei Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung (Haftanstalt, Therapieeinrichtung, Einrichtung der Jugendhilfe)
- Beratung bei der Schuldenregulierung und beim Umgang mit Finanzen.
Die Leistung wird ohne Nachweis von Einkommen und Vermögen erbracht, soweit im Einzelfall Dienstleistungen erforderlich sind.
Voraussetzungen
Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Personen, die in besonders schwierige Lebensverhältnisse geraten sind und diese aus eigener Kraft nicht überwinden können.
Schwierige Lebensverhältnisse können zum Beispiel sein:
- Fehlender oder nicht ausreichender Wohnraum,
- Ungesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage,
- Gewaltgeprägte Lebensumstände,
- Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder
- Vergleichbare nachteilige Umstände.
Erforderliche Unterlagen
- Antrag auf Sozialhilfe
- Gültige Personaldokumente, gegebenenfalls Meldebestätigung
- Der Umfang der für die Beratung benötigten Unterlagen richtet sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls. Dies kann auch Einkommens- und Vermögensnachweise erforderlich machen.
Verfahrensablauf
Nach Antragstellung werden die von Ihnen eingereichten Unterlagen geprüft. Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid. Die Leistung erfolgt ab Antragstellung.
Bearbeitungsdauer
Über den Antrag wird so schnell wie möglich entschieden. Die Bearbeitungsdauer hängt unter anderem von der Vollständigkeit der Angaben und der Vorlage der für die Antragstellung erforderlichen Nachweise ab.
Online-Identifizierung
Mit der BundID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein BundID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
Weiterführende Informationen
Mehr Informationen zu den Angeboten für Menschen in sozialen Schwierigkeiten finden Sie auf www.lvr.de
Hinweise
Obwohl ein formloser Antrag möglich ist, benötigen wir von Ihnen im Nachgang das ausgefüllte Antragsformular.
Hier gelangen Sie zum Online-Antrag auf Leistungen der Sozialhilfe

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRHilfe zur Gesundheit
Bei Zutreffen der folgenden Punkte:
- Sie sind nicht krankenversichert,
- Eine Zuständigkeit durch den LVR ist gegeben (s. Hinweise/Besonderheiten),
- Sie beziehen bereits Eingliederungshilfe durch den LVR
stellt der LVR unmittelbar durch Ausstellen eines Behandlungsscheins die notwendige medizinische Versorgung sicher.
Dazu gehören zum Beispiel:
- Vorbeugende Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung (auch: Hilfe bei Sterilisation) – hierbei handelt es sich um eine freiwillige Leistung
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Voraussetzungen
- Ausschluss vorrangiger Leistungen (u.a. Krankenversicherung, Unfallversicherung, Versorgung der Opfer des Krieges, Asylbewerberleistungsgesetz)
- Behandlungsschein (die Hilfe ist in Form von Sach- und Dienstleistungen sicherzustellen)
- Bei berechtigter Selbsthilfe (z.B. Notfall) ist die Erstattung von bereits ausgelegten Kosten möglich
Erforderliche Unterlagen
- Formloser Antrag zur Ausstellung eines/ Behandlungsschein
- Personalausweis oder Pass
- Gegebenenfalls erforderliche Beratungsbestätigungen, Kostenvoranschläge, Ablehnungsbescheide
Verfahrensablauf
Der LVR prüft Ihren Antrag. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erfolgen, abhängig von der jeweiligen Situation, die weiteren Schritte.
- Befinden Sie beispielsweise sich zum Zeitpunkt der Antragstellung im Krankenhaus werden nach erfolgter Bewilligung die Kosten für die Krankenbehandlung übernommen.
- Befinden Sie sich zum Zeitpunkt der Antragstellung in einem Wohnheim übernimmt der LVR für Sie zum Beispiel die Anmeldung bei einer Krankenkasse.
Fristen
Der zuständige Sozialhilfeträger kann erst einen Behandlungsschein ausstellen, ab dem Zeitpunkt, ab dem er von dem Bedarf Kenntnis erhalten hat. Deshalb ist es wichtig, möglichst zeitnah einen Antrag zu stellen.
Bearbeitungsdauer
Über den Antrag wird schnellstmöglich entschieden, insbesondere wenn erkennbare Dringlichkeit vorliegt.
Online-Identifizierung
Mit der BundID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein BundID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen finden Sie auf des Internetseite des Landschaftsverbandes Rheinland unter
Hinweise
Obwohl ein formloser Antrag möglich ist, benötigen wir von Ihnen im Nachgang das ausgefüllte Antragsformular.
Es besteht nur Zuständigkeit für Hilfe zur Gesundheit, wenn die Person wesentlich geistig, seelisch oder körperlich behindert ist.
Hier gelangen Sie zum Online-Antrag auf Leistungen der Sozialhilfe

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRHilfen für psychisch kranke Personen
Menschen mit einer psychischen Erkrankung leiden unter folgenden Krankheiten oder Störungen:
- geistige oder seelische Krankheit,
- geistige oder seelische Störung von erheblichem Ausmaß,
- Suchterkrankung
Wenn auch Sie von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, können Sie mit Fachkräften über Behandlungen sprechen. Alle angebotenen Hilfen können Sie freiwillig in Anspruch nehmen.
- Die Kontakt- und Beratungsstellen der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) bieten Ihnen kostenlos Hilfen bei psychischen Erkrankungen und seelischen Belastungen an.
- Unterstützung erhalten Sie auch von Selbsthilfegruppen sowie ehrenamtlich tätigen Personen in Ihrer Nähe.
- Für Opfer von Gewalttaten halten die OEG-Traumaambulanzen spezialisierte und sofort verfügbare Angebote bereit.
- Zentrale Anlaufstellen für die Behandlung seelischer Erkrankungen finden Sie z. B. in den LVR-Kliniken: diese bieten sowohl ambulante als auch (teil-)stationäre psychiatrische Versorgung an.
Im Notfall finden Sie hier die Kontaktnummern, wo Sie schnelle und kompetente Hilfe finden.
Auch wenn Sie mit einem Menschen mit einer psychischen Erkrankung zusammenleben, können Sie Hilfen, insbesondere die Beratung, in Anspruch nehmen.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRArchivbestände nutzen
Sie können z.B. zu wissenschaftlichen Zwecken, für heimatkundliche Fragestellungen, zur Erforschung der eigenen Familie oder zur Klärung von Rechtsfragen Archivgut im Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland einsehen.
Das Archiv steht Ihnen bei der Recherche der gesuchten Informationen in den eigenen Beständen durch Beratung sowie durch die Bereitstellung von Findmitteln zur Seite und hilft Ihnen, die Unterlagen zu finden, die Antwort auf Ihre Fragen geben können.
Archivalien (soweit sie keiner Schutzfrist unterliegen) können während der Öffnungszeiten im Lesesaal des Archivs eingesehen werden.
Es ist ebenfalls möglich, Reprografien (Kopien oder Scans) von Archivalien fertigen zu lassen, soweit es deren Erhaltungszustand und die rechtlichen Vorschriften zulassen. Die jeweils aktuellen Preise können bei der Nutzung nachgefragt werden. Weitere Details regelt die Nutzungsordnung.
Voraussetzungen
Die Benutzung steht grundsätzlich sowohl der Wissenschaft als auch interessierten Bürger*innen frei. Die Voraussetzungen für die Einsichtnahme in Archivgut sind in der Nutzungsordnung des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland festgelegt.
Rechtsgrundlage
§ 10 Bundesarchivgesetz (BArchG)
§ 10 Absatz 5 Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW)
Erforderliche Unterlagen
- Ggf. Personalausweis
- Ggf. Nachweis über das Verwandtschaftsverhältnis
Verfahrensablauf
Gern können Sie vorab telefonisch Kontakt zu uns aufnehmen. Ihre Anfrage können Sie dann sowohl über das Online-Formular als auch auf dem Postweg oder per E-Mail an das Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland richten. Dort wird Ihre Anfrage bearbeitet. Sie erhalten eine schriftliche Antwort des Archivs, bei Anfrage per E-Mail und Online-Formular zumeist auch als E-Mail. Wünschen Sie das Archiv direkt zu benutzen, so ist dies nach Terminvereinbarung während der Öffnungszeiten möglich.
Fristen
Es bestehen keine rechtlichen Fristen, um die Leistung in Anspruch nehmen zu können.
Bearbeitungsdauer
Je nach Umfang der Anfrage 1-3 Werktage.
Kosten
Die Beratung der Nutzer*innen und die Vorlage von Archivalien sind unentgeltlich.
Entstehende Sachkosten, Sonderleistungen oder Entgelte für Reproduktionen werden nach der Entgeltordnung des Archivs des LVR berechnet.
Zahlungsarten
Die Zahlung erfolgt über Rechnungsstellung.
Online-Identifizierung
Mit der BundID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein BundID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRLVR-Zentrales Beschwerdemanagement
Haben Sie positive oder negative Rückmeldungen zur Arbeit des LVR? Dann wenden Sie sich gerne an das Team des LVR-Zentralen Beschwerdemanagements.
Dies gilt unabhängig davon, auf welchen Aufgabenbereich des LVR sich Ihre Anregung oder Ihre Beschwerde bezieht.
Als neutrale und unabhängige Stelle nehmen wir Ihr Anliegen auf und sorgen für eine ergebnisoffene Klärung und zeitnahe Rückmeldung.
Sie können uns telefonisch, schriftlich oder auch persönlich nach Vereinbarung erreichen. Zudem können Sie uns über das folgende Formular kontaktieren.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRUnterstützung für volljährige Menschen mit Behinderungen beantragen (Eingliederungshilfe)
Eingliederungshilfe ist dafür da, dass Menschen mit Behinderungen so leben können, wie sie es möchten. Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können.
Wenn Sie einen Antrag stellen, möchten die Mitarbeiter des Landschaftsverbandes herausfinden, was Sie genau brauchen. Dazu führen sie ein persönliches Gespräch mit Ihnen oder lesen es in den Unterlagen nach, die Sie eingereicht haben.
Menschen, die ohne Unterstützung nicht alleine in ihrer eigenen Wohnung leben können, können zum Beispiel Assistenzleistungen bekommen. Das ist möglich
- in der eigenen Wohnung,
- in einer frei gewählten Wohngemeinschaft oder
- in einer besonderen Wohnform.
Es gibt noch weitere Leistungen. Diese sind zum Beispiel:
- Leistungen für Wohnraum
Dabei handelt es sich um Geräte oder bauliche Maßnahmen, die den Alltag erleichtern, wie zum Beispiel Rampen und Treppenlifte. - Leistungen zur Mobilität
Diese Leistung können Menschen erhalten, die wegen der Art und Schwere der Behinderung öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen können. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
Menschen mit Behinderungen können auch als Gast in einer Familie leben. Die Familie unterstützt sie bei einer möglichst selbstbestimmten und eigenständigen Lebensführung. - Leistungen zur Förderung der Verständigung
Diese Leistung soll Menschen mit Hör- und/oder Sprachbehinderungen bei besonderen Anlässen den Kontakt mit anderen Menschen ermöglichen oder erleichtern, zum Beispiel durch Gebärdensprachdolmetscher. - Hilfsmittel
Hilfsmittel sind Gegenstände, die Menschen mit Behinderungen dabei helfen sollen, mögliche Einschränkungen auszugleichen. - Elternassistenz
Die Elternassistenz soll Eltern mit Behinderungen dabei helfen, gemeinsam mit ihren Kindern den Alltag möglichst selbstbestimmt und eigenständig zu bewältigen. - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Es werden Fähigkeiten trainiert, um den Alltag bewältigen zu können (zum Beispiel Kochen, Orientierung). Meistens treffen sich mehrere Personen in einer Gruppe und üben zusammen.
Auch die Form der Leistung kann unterschiedlich sein. Neben Sachleistungen - etwa die Finanzierung eines Leistungserbringers – sind auch Pauschalen oder Geldleistungen im Rahmen des Persönlichen Budgets möglich.
Ihre Fragen können Sie gerne – telefonisch oder persönlich - vor Ort stellen. Der Landschaftsverband informiert auch über Unterstützungsmöglichkeiten anderer Leistungsträger, wie z.B. Krankenkassen oder dem örtlichen Sozialamt.
Voraussetzungen
Sie haben einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Das sind die Voraussetzungen:
1. Sie sind aufgrund Ihrer Behinderung oder einer bald eintretenden Behinderung wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt. Dies können wesentliche körperliche, geistige oder seelische Behinderungen oder Sinnesbeeinträchtigungen sein.
Das heißt, Sie können wegen Ihrer Behinderung viele Dinge im Alltag, im Berufsleben oder in anderen Bereichen im Leben nicht machen oder haben dabei große Schwierigkeiten.
2. Die Leistung ist geeignet und erforderlich, eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.
Das heißt, die Leistung ist gut und kann Ihnen helfen, damit Sie Ihr Leben so führen können, wie Sie es möchten und damit Sie am Leben in der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können. Ohne diese Leistung wäre das nicht möglich.
3. Es besteht die Aussicht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.
Das bedeutet: Es muss möglich sein, dass Sie mit der Leistung die Ziele der Eingliederungshilfe erreichen.
Eventuell müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist abhängig von der Leistung, die Sie beantragt haben.
Rechtsgrundlage
Grundsätzliche Informationen:
§ 99 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
§ 102 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Weiterführende Regelungen:
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 111 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe gemäß § 113 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung gemäß § 112 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)
- Medizinische Rehabilitation § 109 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) (nur in Bezug auf Entwöhnungen und Adaptionen)
- Zuständigkeit der Landschaftsverbände für Eingliederungshilfe-Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderungen gemäß § 1 Absatz 1 AG SGB IX NRW
- Beratung und Unterstützung gemäß § 106 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Bedarfsermittlung gemäß § 118 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Regelungen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen gemäß Teil 2, Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Kapitel 9
Rechtsbehelfe
- Widerspruch
- sozialgerichtliche Klage
Sprachen
- Das Verfahren wird grundsätzlich in deutscher Sprache durchgeführt
- Bei Beratung und Antragstellung kann bei Bedarf durch Sie eine dolmetschende Person hinzugezogen werden
- Bitte geben Sie an, wenn eine gebärdensprachdolmetschende Person erforderlich ist. Die Kosten hierfür werden vom Landschaftsverband übernommen.
Erforderliche Unterlagen
- Erforderlich ist ein Antrag, der jedoch formlos oder auch mündlich erfolgen kann.
- Persönliche Daten mit Ergänzung entsprechender Nachweise
- Nachweis über die Behinderung (fachärztliche Bescheinigung)
- Bei Unterstützung durch Dritte: Vollmacht (wenn Sie andere Personen um Hilfe beim Antrag bitten)
- Bei Betreuung: Betreuungsurkunde (wenn Sie einen rechtlich bestellten Betreuer haben)
- Bei Pflegegrad: Bescheid der Pflegekasse über Feststellung des Pflegegrades
- Ggf. Nachweise zum Einkommen und Vermögen
- Abhängig von der beantragten Leistung werden ggf. weitere Unterlagen benötigt
- Im Beratungsgespräch klären die Mitarbeitenden mit Ihnen, welche weiteren Unterlagen erforderlich sind
Verfahrensablauf
Sie können Eingliederungshilfe bei Ihrem zuständigen Landschaftsverband (Landschaftsverband Rheinland, LVR oder Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) beantragen.
Innerhalb von 2 Wochen ab Antragseingang wird die Zuständigkeit geprüft. Sollte ein anderer Träger zuständig sein, wird Ihr Antrag unverzüglich weitergeleitet. Über eine Weiterleitung werden Sie informiert.
Sie werden bei Bedarf aufgefordert, Unterlagen nachzureichen.
Die erforderlichen Unterstützungsleistungen werden mit Ihnen gemeinsam ermittelt.
Beantragen Sie eine Wohnhilfe wie z.B. Betreutes Wohnen, werden Sie zu einem Gespräch eingeladen.
Sie erhalten einen Bescheid über Ihren Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Sie müssen dem Landschaftsverband Änderungen Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse immer zeitnah mitteilen.
Eine Überprüfung der bewilligten Leistungen erfolgt in der Regel spätestens alle 2 Jahre. Wenn sich zwischendurch etwas ändert, informieren Sie den Landschaftsverband. Dann wird die Leistung angepasst.
Fristen
Die Leistungen werden frühestens ab dem Ersten des Monats der Antragstellung erbracht, wenn zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen bereits vorlagen.
Bearbeitungsdauer
Die Dauer des Prozesses aus Beratung, Bearbeitung und Abstimmung mit anderen Leistungsträgern ist abhängig vom Einzelfall und daher sehr unterschiedlich. Sie können den Prozess beschleunigen, wenn Sie zeitnah alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung stellen.
Kosten
Es fallen keine Gebühren an für die Antragsstellung. Sollten Kosten entstehen, können Sie das gerne vorab mit ihrem zuständigen Landschaftsverband klären.
Online-Identifizierung
Es ist keine Online-Identifizierung erforderlich.
Zur Übernahme Ihrer persönlichen Daten in das Formular können Sie das ServiceKonto.NRW nutzen.
Weiterführende Informationen
Für den LVR:
- Allgemeinen Informationen zu den Leistungen des LVR-Dezernates für Menschen mit Behinderungen:
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung.jsp - Unterstützung und Beratung im Bereich Wohnen und Alltag
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/wohnen-und-alltag/ - Unterstützung und Beratung im Bereich Arbeit und Behinderung
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/arbeit-und-behinderung/
- Allgemeine Beratung vor Ort zu weiteren Leistungen
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/allgemeine-beratung-und-unterstuetzung-fuer-menschen-mit-behinderung/ - Informationen zur Bedarfsermittlung
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/wohnen-und-alltag-mit-behinderung/bedarfsermittlung-fuer-menschen-mit-behinderung/
Hier gelangen Sie zum Online-Antrag für Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
Für den LWL:
Allgemein:

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRZustimmung zur Kündigung schwerbehinderter Menschen beantragen
Schwerbehinderte Menschen und gleichgestellte behinderte Personen sind vor Kündigungen besonders geschützt. Deshalb müssen Sie die Zustimmung des Integrationsamtes (in Bayern und Nordrhein-Westfalen: Inklusionsamt) einholen, bevor Sie die Kündigung aussprechen.
Die Zustimmung ist unabhängig vom Grund der beabsichtigten Kündigung (personen-, betriebs- oder verhaltensbedingt) erforderlich. Der Sonderkündigungsschutz gilt auch unabhängig davon, wie groß Ihr Betrieb ist.
Die Zustimmung des Integrationsamtes brauchen Sie bei allen Arten von Kündigungen, also bei:
- ordentlichen Kündigungen,
- außerordentlichen (fristlosen) Kündigungen sowie
- Änderungskündigungen.
Neben dem eigentlichen Kündigungsgrund berücksichtigt das Integrationsamt bei seiner Entscheidung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen erforderlichen Abwägung der gegenseitigen Interessen beispeilsweise:
- Größe und wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers und
- Erfüllung der Beschäftigungspflicht
sowie:
- Art und Schwere der Behinderung,
- Alter,
- persönliche Verhältnisse des schwerbehinderten Menschen,
- die Dauer der Betriebszugehörigkeit und
- seine Chancen, bei einer etwaigen Entlassung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen anderen Arbeitsplatz zu finden.
Insbesondere bei personen- und verhaltensbedingten Kündigungen wird im Kündigungsschutzverfahren geklärt, was der Betrieb beziehungsweise die Dienststelle sowie das betriebliche Integrationsteam zur Abwendung der Kündigung im Vorfeld getan haben und ob gegebenenfalls Maßnahmen im Rahmen der Prävention veranlasst wurden.
Bei außerordentlichen (fristlosen) Kündigungen prüft das Integrationsamt, ob die Kündigung im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung steht. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt es der Kündigung zu und eröffnet so den Gang zum Arbeitsgericht.
Eine Kündigung, die Sie ohne Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung (soweit im Betrieb vorhanden) aussprechen, ist unwirksam.
Eine ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochene Kündigung ist ebenfalls unwirksam. Sie kann auch nicht nachträglich durch das Integrationsamt genehmigt werden.
Sie brauchen nur dann keine Zustimmung, wenn der oder die schwerbehinderte Beschäftigte:
- selbst kündigt,
- weniger als 6 Monate in Ihrem Betrieb arbeitet,
- das 58. Lebensjahr vollendet hat und einen Anspruch auf eine Abfindung oder ähnliche Leistung hat,
- bei Kündigung aus Witterungsgründen, wenn seitens des Arbeitsgeber eine verbindliche Wiedereinstellungszusage gegeben wird,
- wenn zum Zeitpunkt der Kündigung der Status als schwerbehinderter Mensch nicht von den dafür zuständigen Behörden festgestellt werden konnte oder
- das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung, zum Beispiel durch einen Aufhebungsvertrag beendet wird.
Voraussetzungen
- Anerkennung als schwerbehinderter Mensch: es muss vom Versorgungsamt ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 festgestellt worden sein.
- Gleichstellung: bei einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 muss die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen von der Agentur für Arbeit erteilt worden sein.
Erforderliche Unterlagen
- Schwerbehindertenausweis
- Anerkennungsbescheid des Versorgungsamtes über die Schwerbehinderung (wird vom Integrationsamt bei Beschäftigten angefordert. Der Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf dieses Dokument)
- Gleichstellungsbescheid der Agentur für Arbeit
- Tätigkeitsbeschreibung
- ausführliche Begründung der Kündigungsabsicht
Verfahrensablauf
Die Zustimmung zur Kündigung eines schwerbehinderten Menschen müssen Sie schriftlich beantragen:
- Kontaktieren Sie Ihr regionales Integrations- oder Inklusionsamt, um das Antragsformular auf Zustimmung zur Kündigung zu erhalten. Füllen Sie dieses vollständig aus und senden Sie es mit den erforderlichen Unterlagen an das Integrationsamt.
- Nach Erhalt des Antrags auf Zustimmung zur Kündigung prüft das Integrationsamt den Sachverhalt. Dazu hört es den schwerbehinderten Menschen an und holt die Stellungnahme des Betriebs- oder Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung ein.
-> Tipp: Sie können im Vorfeld bereits selbst die Stellungnahme des Betriebs- oder Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung einholen und Ihrem Antrag hinzufügen. - Falls erforderlich, schaltet das Integrationsamt auch Fachkräfte ein (zum Beispiel den Integrationsfachdienst oder den Technischen Beratungsdienst) und holt weitere Stellungnahmen und Gutachten ein. Zur Sachverhaltsaufklärung kann es auch Zeugenvernehmungen durchführen.
- Das Integrationsamt ist verpflichtet, in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Das kann besonders gut in einer mündlichen Verhandlung mit allen Beteiligten geschehen.
- Im Rahmen einer gütlichen Einigung kann das Integrationsamt auch Leistungen der Begleitenden Hilfe im Arbeitsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe anbieten, zum Beispiel zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung oder zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung des schwerbehinderten Menschen verbunden sein können.
- Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, trifft das Integrationsamt nach pflichtgemäßem Ermessen und Abwägung der gegenseitigen Interessen der beiden Parteien eine Entscheidung über den Antrag. Bei Kündigungen in Zusammenhang mit Betriebseinstellungen, wesentlichen Betriebseinschränkungen und Insolvenzen gelten Sonderregelungen.
- Das Integrationsamt erlässt dazu einen Kündigungsbescheid, der adressiert ist an Sie als Antragsteller und gleichzeitig an den Beschäftigten als Verfahrensbeteiligten. Der Bescheid enthält neben der Entscheidung eine ausführliche Begründung und einen Rechtsbehelf.
Fristen
- Zustimmung zur außerordentlichen (fristlosen) Kündigung: Sie müssen unverzüglich nach Zustimmung des Integrationsamtes die Kündigung aussprechen. Unverzüglich meint hier innerhalb von 3 Werkstagen. Versäumen Sie diese Frist, ist die Zustimmung des Integrationsamtes hinfällig. Sie können dann nur noch ein neues ordentliches Kündigungsverfahren anstreben.
- Zustimmung zur ordentlichen Kündigung: Sie müssen nach Zugang der Zustimmung des Integrationsamtes die Kündigung innerhalb eines Monats aussprechen. Danach erlischt die Zustimmung zu Kündigung. Sie können dann nur noch ein neues ordentliches Kündigungsverfahren anstreben.
Bearbeitungsdauer
- Zustimmung zur außerordentlichen (fristlosen) Kündigung: Entscheidung des Integrationsamtes innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung durch das Integrationsamt, gilt die Zustimmung als erteilt.
- Zustimmung zur ordentlichen Kündigung: Entscheidung des Integrationsamtes innerhalb eines Monats, wenn denn dem Integrationsamt alle Informationen vorliegen, die es benötigt, um eine rechtssichere Entscheidung treffen zu können. Im Mittel beträgt die Bearbeitungsdauer bundesweit 7 Wochen.
Formulare
Weiterführende Informationen
Informationen zum besonderen Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen auf der Internetseite des LVR-Inklusionsamtes
Informationen zur Fachberatung bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf der Internetseite des LVR-Inklusionsamtes
Informationen zu Förderungen und Hilfen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf der Internetseite des LVR-Inklusionsamtes

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRBlindengeld beantragen
Als blinder Mensch haben Sie in Nordrhein-Westfalen (NRW) Anspruch auf Blindengeld in folgender monatlicher Höhe:
• Kinder und Jugendliche: 440,90 Euro
• Erwachsene unter 60 Jahre: 880,28 Euro
• Erwachsene ab 60 Jahre: 473,00 Euro
Diese Leistung erhalten Sie unabhängig von Einkommen und Vermögen.
Wenn Sie 60 Jahre oder älter sind, können Sie den Differenzbetrag von 407,28 Euro als ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII erhalten.
Für die Blindenhilfe ist ein separater Antrag notwendig.
Anrechnungen auf das Blindengeld:
Wenn Sie in einer stationären oder ähnlichen Einrichtung oder in einem Pflegeheim leben und die Kosten ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln übernommen werden, kann Ihr Blindengeld unter bestimmten Voraussetzungen gekürzt werden.
Wenn Sie 18 Jahre oder älter sind und Sie erhalten Leistungen der Pflegekasse, der privaten Pflegeversicherung oder der Beihilfe wegen häuslicher Pflege, Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, dann wird Ihr Blindengeld monatlich gekürzt:
• um 179,28 Euro (Pflegegrad 2)
• um 166,17 Euro (Pflegegrade 3 bis 5)
Voraussetzungen
- Sie gelten als blind, wenn Ihr besseres Auge nicht mehr als 2% Sehkraft hat oder eine gleichwertige Einschränkung aufweist.
- Sie wohnen in Nordrhein-Westfalen.
- Sie haben einen durch Ihre Erblindung entstandenen Mehraufwand.
Rechtsbehelfe
verwaltungsgerichtliche Klage
Beratungsangebote des LVR
Erforderliche Unterlagen
- Persönliche Daten mit Ergänzung entsprechender Nachweise nach Aufforderung (in der Regel Personalausweis oder Pass oder Aufenthaltstitel).
- Nachweis über die Erblindung (mindestens ein Nachweis erforderlich):
o Fachärztliche Bescheinigung über die Erblindung
o Bescheid zum Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „Bl“ (blind)
- Bei Antragstellung für Minderjährige: Willenserklärung der gesetzlichen Vertretung (wenn Sie Erziehungsberechtigte sind)
- Bei Unterstützung durch Dritte: Vollmacht (wenn Sie dritte Personen um Hilfe beim Antrag bitten)
- Bei Betreuung: Betreuungsurkunde (wenn Sie einen rechtlich bestellten Betreuer haben)
- Bei Angabe eines fremden Kontos: Fremdkontenerklärung
- Bei Ansprüchen gegenüber Dritten: Nachweis über die Ansprüche
- Bei Inanspruchnahme oder Beantragung von Leistungen auf Basis anderer Rechtsgrundlagen: Nachweise über die Leistungen
- Bei Vorliegen eines Pflegegrades: Bewilligungsbescheid der Pflegekasse, Beihilfe- /Fürsorgestelle des Sozialamtes
Verfahrensablauf
Sie können Blindengeld bei Ihrem zuständigen Landschaftsverband (Landschaftsverband Rheinland, LVR oder Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) beantragen.
Sie können den Antrag auf Blindengeld auch bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung oder Kreisverwaltung einreichen.
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung vom Landschaftsverband.
Sie werden bei Bedarf aufgefordert, Unterlagen nachzureichen.
Sie erhalten eine Entscheidung über Ihren Anspruch auf Blindengeld.
Sie müssen dem Landschaftsverband Änderungen Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse immer zeitnah mitteilen.
Fristen
Sie erhalten das Blindengeld ab dem Monat, in dem Sie Ihren Antrag eingereicht haben und die Voraussetzungen für die Leistung vorlagen.
Bearbeitungsdauer
Wenn Sie alle benötigten Unterlagen eingereicht haben, erhalten Sie eine Entscheidung nach der Prüfung.
Kosten
- keine Antragsgebühren
- Auslagen für ärztliche Nachweise sind durch Sie zu tragen
Zahlungsarten
entfällt
Online-Identifizierung
- Mit der Bund ID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein Bund ID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
- Mit Mein Unternehmenskonto können Sie Ihre Identität nachweisen, wenn Sie für eine Organisation tätig sind und die Leistung für Dritte beantragen.
Weiterführende Informationen
Informationen zu Blindengeld und Blindenhilfe beim Landschaftsverband Rheinland (LVR)
Informationen zu Blindengeld und Blindenhilfe beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)
Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.
Hinweise
Blindengeld können Sie nicht gleichzeitig mit Hilfen für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung erhalten.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRBlindenhilfe in NRW beantragen
Als blinder Mensch haben Sie in Nordrhein-Westfalen (NRW) Anspruch auf Blindenhilfe.
Sie müssen 60 Jahre oder älter sein.
Die Höhe der Blindenhilfe beträgt bis zu 407,28 Euro im Monat.
Diese Leistung ist abhängig von der Höhe Ihres Einkommens und Vermögens.
Anrechnungen auf die Blindenhilfe:
Wenn Sie in einer stationären oder ähnlichen Einrichtung oder in einem Pflegeheim leben und die Kosten ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln übernommen werden, kann Ihr Blindenhilfe unter bestimmten Voraussetzungen gekürzt werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Blindenhilfe auch durch den örtlichen Träger bewilligt werden.
Wenn Sie Leistungen von der Pflegekasse, der privaten Pflegeversicherung oder der Beihilfe erhalten, kann dies zu einer Änderung der Höhe Ihrer bewilligten Blindenhilfe führen.
Voraussetzungen
- Sie gelten als blind, wenn Ihr besseres Auge nicht mehr als 2% Sehkraft hat oder eine gleichwertige Einschränkung aufweist.
- Sie wohnen in Nordrhein-Westfalen.
- Sie haben einen durch Ihre Erblindung entstandenen Mehraufwand.
Rechtsbehelfe
- Widerspruch
- sozialgerichtliche Klage
Erforderliche Unterlagen
- Persönliche Daten mit Ergänzung entsprechender Nachweise nach Aufforderung (in der Regel Personalausweis oder Pass oder Aufenthaltstitel).
- Nachweis über die Erblindung (mindestens ein Nachweis erforderlich):
o Fachärztliche Bescheinigung über die Erblindung
o Bescheid zum Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „Bl“ (blind)
- Nachweise zu Ihrem aktuellen Einkommen und Vermögen
- Bei Unterstützung durch Dritte: Vollmacht (wenn Sie dritte Personen um Hilfe beim Antrag bitten)
- Bei Betreuung: Betreuungsurkunde (wenn Sie einen rechtlich bestellten Betreuer haben)
- Bei Angabe eines fremden Kontos: Fremdkontenerklärung
- Bei Ansprüchen gegenüber Dritten: Nachweis über die Ansprüche
- Bei Inanspruchnahme oder Beantragung von Leistungen auf Basis anderer Rechtsgrundlagen: Nachweise über die Leistungen
- Bei Vorliegen eines Pflegegrades: Bewilligungsbescheid der Pflegekasse, Beihilfe- /Fürsorgestelle des Sozialamtes
Verfahrensablauf
Sie können Blindenhilfe bei Ihrem zuständigen Landschaftsverband (Landschaftsverband Rheinland, LVR oder Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) beantragen.
Sie können den Antrag auf Blindenhilfe auch bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung oder Kreisverwaltung einreichen.
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung vom Landschaftsverband.
Sie werden bei Bedarf aufgefordert, Unterlagen nachzureichen.
Sie erhalten eine Entscheidung über Ihren Anspruch auf Blindenhilfe.
Sie müssen dem Landschaftsverband Änderungen Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse immer zeitnah mitteilen.
Fristen
- Sie erhalten die Blindenhilfe ab dem Zeitpunkt, an dem Sie gegenüber dem zuständigen Landschaftsverband klar erkennbar geäußert haben, dass Sie Blindenhilfe haben wollen.
- Die Blindenhilfe ist eine Sozialhilfeleistung, die monatlich gewährt wird. Wenn sich Ihr Einkommen und Vermögen ändert, müssen Sie das dem zuständigen Landschaftsverband mitteilen.
Bearbeitungsdauer
Wenn Sie alle benötigten Unterlagen eingereicht haben, erhalten Sie eine Entscheidung nach der Prüfung.
Kosten
- Keine Antragsgebühren
- Auslagen für ärztliche Nachweise sind durch Sie zu tragen
Zahlungsarten
entfällt
Online-Identifizierung
Mit der BundID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein BundID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
Weiterführende Informationen
Informationen zu Blindengeld und Blindenhilfe beim Landschaftsverband Rheinland (LVR)
Informationen zu Blindengeld und Blindenhilfe beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)
Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.
Hinweise
Das Blindengeld ist in NRW eine vorrangige Leistung. Blindenhilfe kann in NRW in der Regel nur als Ergänzungsleistung ab dem 60. Lebensjahr beantragt werden.
Hier gelangen Sie zum Online-Antrag auf Leistungen der Sozialhilfe

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRAusgleichsabgabe bei Nichtbeschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung
Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich mindestens 60 Arbeitsplätzen müssen derzeit auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Solange der Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl nicht erreicht, ist er / sie zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet.
Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt. Sie ist, je nach Erfüllung der Beschäftigungspflicht, gestaffelt.
Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht auf.
Die Mittel der Ausgleichsabgabe sind zweckgebunden und werden ausschließlich zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben verwendet.
Voraussetzungen
Der Arbeitgeber
- verfügt über jahresdurchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätze
- beschäftigt nicht auf mindestens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen (siehe Ausnahmeregelung)
Die dann zu zahlende Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetztem Pflichtplatz derzeit:
- 140,00 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz (derzeit 5 Prozent)
- 245,00 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent
- 360,00 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent
Für Arbeitgeber mit Arbeitsplätzen unter 60 bestehen Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Höhe der Ausgleichsabgabe:
- Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 Arbeitsplätzen müssen einen schwerbehinderten Menschen beschäftigen – sie zahlen je Monat nur 140,00 Euro, wenn sie diesen Pflichtplatz nicht besetzen.
- Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplätzen müssen 2 Pflichtplätze besetzen – sie zahlen 140 Euro, wenn sie nur einen Pflichtplatz besetzen und 245,00 Euro, wenn sie keinen schwerbehinderten Menschen beschäftigen.
Rechtsgrundlage
Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX)
§ 154 „Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen“
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160 „Ausgleichsabgabe“
§ 163 „Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern“
Rechtsbehelfe
- Widerspruch; innerhalb eines Monats
- Verwaltungsgerichtliche Klage
Erforderliche Unterlagen
Anzuzeigen sind:
- die Zahl der Arbeitsplätze
- die Zahl der in den einzelnen Betrieben beschäftigten schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen sowie der sonstigen anrechnungsfähigen Personen
- Hierzu ist gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle ein Verzeichnis der schwerbehinderten Beschäftigten vorzulegen.
- Mehrfachanrechnungen (der Arbeitgeber darf unter bestimmten Voraussetzungen bei der Veranlagung zur Ausgleichsabgabe einen schwerbehinderten Arbeitnehmer auf 2 oder 3 Pflichtplätze anrechnen)
- der Gesamtbetrag der geschuldeten Ausgleichsabgabe
Verfahrensablauf
Für das Anzeigeverfahren ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig. Hierzu gehören die tatsächliche und rechtliche Prüfung der Daten, die
- für die Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht
- zur Überwachung ihrer Erfüllung
- für die Berechnung der Ausgleichsabgabe
erforderlich sind.
Die Berechnung der Ausgleichsabgabe erfolgt im Wege der Selbstveranlagung durch die Arbeitgeber anhand der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Anforderung zur Verfügung gestellten Vordrucke oder elektronisch mit der kostenlosen Software IW-Elan.
Nach Prüfung der Anzeigen durch die Agentur für Arbeit werden diese zur Durchführung des Erhebungsverfahrens an das zuständige Integrations- bzw. Inklusionsamt weitergeleitet. Dieses überwacht den fristgerechten Zahlungseingang, prüft die Anrechnungsfähigkeit der Arbeitsleistung von Werkstätten für behinderte Menschen und Blindenwerkstätten, stellt die Ausgleichsabgabe fest, erlässt bei rückständiger Ausgleichsabgabe einen Feststellungsbescheid und betreibt die Einziehung.
Fristen
Veranlagungspflichtige Arbeitgeber müssen die Anzeige bis zum 31.03. eines Jahres an die zuständige Stelle übermitteln und bei Zahlungspflicht die Ausgleichsabgabe zahlen.
Bearbeitungsdauer
Die Anzeigefrist endet jeweils am 31. März des Folgejahres; die Zahlung ist dann ebenfalls fällig.
Bei einem Rückstand von mehr als 3 Monaten erlässt das Integrations-, Inklusionsamt einen Feststellungsbescheid über rückständige Beträge und erhebt einen Säumniszuschlag, der ein Prozent für jeden angefangenen Monat nach Fälligkeit beträgt.
Zahlungsarten
Per Überweisung an das für Sie zuständige Integrations-, Inklusionsamt
Weiterführende Informationen
Informationen zur Ausgleichsabgabe
https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/
Weiterführende Informationen und Erläuterungen zum Anzeigeverfahren erhalten Sie über folgenden Link
Hinweise
- Arbeitgeber, die zur Ausgleichsabgabe verpflichtet sind, können ihre Zahlungspflicht ganz oder teilweise auch dadurch erfüllen, dass sie anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder Blindenwerkstätten Aufträge erteilen. 50 Prozent des auf die Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages (Gesamtrechnungsbetrag abzüglich Materialkosten) können auf die jeweils zu zahlende Ausgleichsabgabe angerechnet werden. Dabei wird die Arbeitsleistung des Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsförderung berücksichtigt, nicht hingegen die Arbeitsleistung sonstiger nicht behinderter Arbeitnehmer.
- Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht auf.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRHilfe für Gehörlose beantragen
Sie haben als Mensch mit einer Gehörlosigkeit oder einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 77,- Euro monatlich.
Sie haben Ihre Behinderung bereits seit Geburt oder bevor Sie 18 Jahre alt geworden sind.
Sie wohnen in Nordrhein-Westfalen.
Diese Leistung erhalten Sie unabhängig von Ihrem Einkommen und Vermögen.
Voraussetzungen
Sie gelten als gehörlos mit angeborener oder bis zum 18. Lebensjahr erworbenen Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit auf beiden Ohren.
Sie wohnen in Nordrhein-Westfalen.
Sie haben einen durch Ihre Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit entstandenen Mehraufwand.
Rechtsbehelfe
verwaltungsgerichtliche Klage
Erforderliche Unterlagen
- Persönliche Daten mit Ergänzung entsprechender Nachweise nach Aufforderung (in der Regel Personalausweis oder Pass oder Aufenthaltstitel).
- Nachweis über die Gehörlosigkeit oder Taubheit (mindestens ein Nachweis erforderlich):
o Fachärztliche Bescheinigung über die Gehörlosigkeit oder Taubheit
o Bescheid zum Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen
„Gl“ (gehörlos)
- Bei Antragstellung für Minderjährige: Willenserklärung der gesetzlichen Vertretung (wenn Sie Erziehungsberechtigte sind)
- Bei Unterstützung durch Dritte: Vollmacht (wenn Sie dritte Personen um Hilfe beim Antrag bitten)
- Bei Betreuung: Betreuungsurkunde (wenn Sie einen rechtlich bestellten Betreuer haben)
- Bei Angabe eines fremden Kontos: Fremdkontenerklärung
- Bei Ansprüchen gegenüber Dritten: Nachweis über die Ansprüche
- Bei Inanspruchnahme oder Beantragung von Leistungen auf Basis anderer Rechtsgrundlagen: Nachweise über die Leistungen
Verfahrensablauf
Sie können Hilfe für Gehörlose bei Ihrem zuständigen Landschaftsverband (Landschaftsverband Rheinland, LVR oder Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) beantragen.
Sie können den Antrag auf Hilfe für Gehörlose auch bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung oder Kreisverwaltung einreichen.
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung vom Landschaftsverband.
Sie werden bei Bedarf aufgefordert, Unterlagen nachzureichen.
Sie erhalten eine Entscheidung über Ihren Anspruch auf Hilfe für Gehörlose.
Sie müssen dem Landschaftsverband Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse immer zeitnah mitteilen.
Fristen
Sie erhalten die Hilfe für Gehörlose ab dem Monat, in dem Sie Ihren Antrag eingereicht haben und die Voraussetzungen für die Leistung vorlagen.
Bearbeitungsdauer
Wenn Sie alle Unterlagen eingereicht haben, erhalten Sie eine Entscheidung nach der Prüfung.
Kosten
- keine Antragsgebühren
- Auslagen für ärztliche Nachweise sind durch Sie zu tragen
Zahlungsarten
entfällt
Online-Identifizierung
- Mit der Bund ID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein Bund ID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
- Mit Mein Unternehmenskonto können Sie Ihre Identität nachweisen, wenn Sie für eine Organisation tätig sind und die Leistung für Dritte beantragen.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVRHilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung beantragen
Wenn Sie 16 Jahre oder älter sind, haben Sie als Mensch mit einer hochgradigen Sehbehinderung in Nordrhein-Westfalen Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 77,- Euro monatlich.
Diese Leistung erhalten Sie unabhängig von Einkommen und Vermögen.
Voraussetzungen
Sie gelten als hochgradig sehbehindert, wenn Ihr besseres Auge mit bestmöglicher Korrektur nicht mehr als 5% Sehkraft hat.
Sie gelten auch als hochgradig sehbehindert mit einer gleichwertigen Einschränkung Ihrer Sehkraft.
Sie wohnen in Nordrhein-Westfalen.
Sie haben einen durch Ihre Sehbehinderung entstandenen Mehraufwand.
Rechtsbehelfe
verwaltungsgerichtliche Klage
Erforderliche Unterlagen
- Persönliche Daten mit Ergänzung entsprechender Nachweise nach Aufforderung (in der Regel Personalausweis oder Pass oder Aufenthaltstitel).
- Nachweis über die Sehbehinderung (mindestens ein Nachweis erforderlich):
o Fachärztliche Bescheinigung über die Sehbehinderung
o Bescheid zum Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „H“ (hilflos)
Das Merkzeichen „H“ muß sich ausschließlich auf die Sehbehinderung beziehen!
- Bei Antragstellung für Minderjährige: Willenserklärung der gesetzlichen Vertretung (wenn Sie Erziehungsberechtigte sind)
- Bei Unterstützung durch Dritte: Vollmacht (wenn Sie dritte Personen um Hilfe beim Antrag bitten)
- Bei Betreuung: Betreuungsurkunde (wenn Sie einen rechtlich bestellten Betreuer haben)
- Bei Angabe eines fremden Kontos: Fremdkontenerklärung
- Bei Ansprüchen gegenüber Dritten: Nachweis über die Ansprüche
- Bei Inanspruchnahme oder Beantragung von Leistungen auf Basis anderer Rechtsgrundlagen: Nachweise über die Leistungen
Verfahrensablauf
Sie können Hilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung bei Ihrem zuständigen Landschaftsverband (Landschaftsverband Rheinland, LVR oder Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) beantragen.
Sie können den Antrag auf Hilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung auch bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Stadtverwaltung oder Kreisverwaltung einreichen.
Sie erhalten eine Eingangsbestätigung vom Landschaftsverband.
Sie werden bei Bedarf aufgefordert, Unterlagen nachzureichen.
Sie erhalten eine Entscheidung über Ihren Anspruch auf Hilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung.
Sie müssen dem Landschaftsverband Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse immer zeitnah mitteilen.
Fristen
Sie erhalten die Hilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung ab dem Monat, in dem Sie Ihren Antrag eingereicht haben und die Voraussetzungen für die Leistung vorlagen.
Bearbeitungsdauer
Wenn Sie alle benötigten Unterlagen eingereicht haben, erhalten Sie eine Entscheidung nach der Prüfung.
Kosten
- keine Antragsgebühren
- Auslagen für ärztliche Nachweise sind durch Sie zu tragen
Zahlungsarten
entfällt
Weiterführende Informationen
- Informationen zu Blindengeld und Blindenhilfe beim Landschaftsverband Rheinland (LVR)
- Informationen zu Blindengeld und Blindenhilfe beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
- Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)
- AMD-Netz e.V. (hier genannt: Sehbehindertengeld)
- Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V.
Hinweise
Hinweis 1:
Mit weniger oder gleich 2% Sehkraft gelten Sie als blind und können die Leistung Blindengeld beantragen.
Hinweis 2:
Hilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung können Sie nicht gleichzeitig mit Blindengeld erhalten.

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVREinrichtungsbezogene Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung bis Schuleintritt
Kinder mit (drohender) Behinderung sollen individuell gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, kommen bis zur Einschulung unterschiedliche Eingliederungshilfeleistungen infrage. Doch welche Unterstützung ist für Ihr Kind die passende? Benötigt es Leistungen der Frühen Förderung oder in der Kindertagesbetreuung, für die der LVR zuständig ist? Oder müssen vielleicht auch andere Kostenträger, wie etwa die Krankenkassen, angesprochen werden?
Bei uns sind Sie mit diesen Fragen genau richtig: Unser LVR-Fallmanagement berät Sie umfassend über mögliche Unterstützungsleistungen für Kinder mit (drohender) Behinderung, telefonisch oder persönlich vor Ort.
Voraussetzungen
Anspruch auf Eingliederungshilfe können Kinder haben, die durch eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben, oder von einer Behinderung bedroht sind. Hiervon werden auch Entwicklungsstörungen erfasst.
Rechtsgrundlage
- Heilpädagogische Leistungen bis zum Schuleintritt gemäß
- Interdisziplinärer Frühförderung gemäß
- Zuständigkeit des LVR für die einrichtungsbezogene Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Schuleintritt gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 und 4 AG SGB IX NRW
- Beratung und Unterstützung gemäß § 106 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
- Bedarfsermittlung gemäß § 118 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Rechtsbehelfe
Widerspruch
Sozialgerichtliche Klage
Beratungsangebote des LVR
Beratungsangebote des LVR finden Sie im Beratungskompass
Sprachen
- Das Verfahren wird grundsätzlich in deutscher Sprache durchgeführt.
- Bei Beratung und Antragstellung kann bei Bedarf auch ein Dolmetscher hinzugezogen werden.
- Dokumente und Bescheide werden teils auch in übersetzten Fassungen angeboten.
Erforderliche Unterlagen
Bitte erfragen Sie in der für Sie zuständigen Beratungsstelle, ob Sie weitere Unterlagen einreichen müssen.
Verfahrensablauf
- Welche Unterstützung ist für Ihr Kind die passende? Benötigt es Leistungen der Frühen Förderung oder in der Kindertagesbetreuung, für die der LVR zuständig ist? Oder müssen vielleicht auch andere Kostenträger, wie etwa die Krankenkassen, angesprochen werden?
Bei uns sind Sie mit diesen Fragen genau richtig.
- Um die Bedarfe frühzeitig zu erkennen, ist eine individuelle Beratung auf Augenhöhe entscheidend. Hierbei werden Eltern von Kindern mit Behinderung über konkrete Hilfsmöglichkeiten und Lösungsansätze informiert.
Die Beratung erfolgt zukünftig direkt in den 26 Mitgliedskörperschaften des LVR. Auf diesem Wege können die Anliegen und Lebenssituationen der Ratsuchenden möglichst optimal berücksichtigt werden. Außerdem kann die Beratung zu einem Antrag auf Leistungen der Eingliederungshilfe führen, bei dem wir Sie unterstützen.
- Im Zuge der Gesamtplanung stellt der LVR als Träger der Eingliederungshilfe den individuellen Bedarf des Kindes mit Behinderung fest. Dies erfolgt durch ein einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument für Kinder und Jugendliche (BEI_NRW KiJu). Hierbei werden insbesondere auch die Wünsche der Leistungsberechtigten berücksichtigt.
Fristen
Grundsätzlich ist für Leistung der Eingliederungshilfe seit 2020 ein Antrag erforderlich.
Bei Bescheiden sind die allgemeinen Fristen zu Widersprüchen bzw. Klagen zu beachten.
Bearbeitungsdauer
Keine (Die Dauer der Beratungsgespräche ist individuell und richtet sich nach dem Bedarf.)
Zahlungsarten
entfällt
Online-Identifizierung
- Mit der Bund ID haben Sie verschiedene Optionen Ihre Identität nachzuweisen. Ein Bund ID-Konto bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, nachdem Sie das Formular an den LVR gesendet haben.
- Mit Mein Unternehmenskonto können Sie Ihre Identität nachweisen, wenn Sie für eine Organisation tätig sind und die Leistung für Dritte beantragen.
Weiterführende Informationen
Für
- Alle allgemeinen Informationen
https://www.bthg.lvr.de
- Allgemeine Beratung vor Ort zu weiteren Leistungen
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/kinder-und-familie/allgemeine-beratung-vor-ort-zu-weiteren-leistungen
- Eingliederungshilfe in der Kindertagesbetreuung
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/eingliederungshilfe-in-der-kindertagesbetreuung/
- Frühe Förderung
https://beratungskompass.lvr.de/alltagssprache/beratungsthemen/fruehe-foerderung/

Alle Leistungen des LVR
Zur Übersicht aller Leistungen des LVR